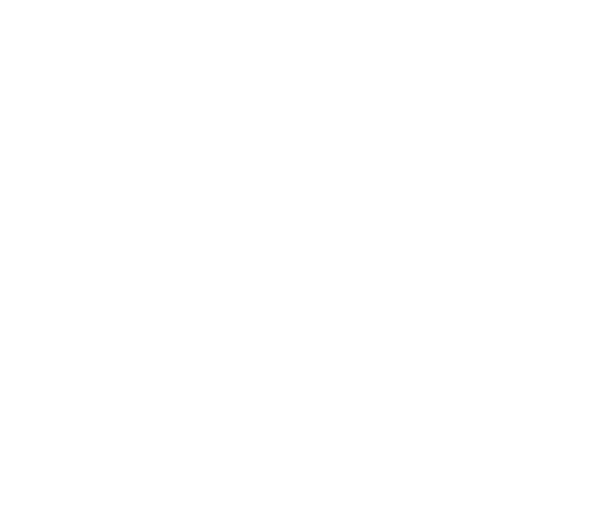Durch seine grosse Höhenausdehnung zwischen 1380 m und 3173 m ü. M. kommen im Schweizerischen Nationalpark (SNP) eine Vielzahl verschiedener Lebensräume vor. Die vom Menschen ungestörten natürlichen Prozesse schaffen ein kleinräumiges Mosaik von verschiedensten Habitaten. Dies schafft die Grundlage für eine grosse Vielfalt von Arten, die im SNP vorkommen. Einige einst ausgerottete Arten wie der Bartgeier und der Steinbock wurden erfolgreich wieder angesiedelt. Andere wie Rothirsch, Braunbär und Wolf sind natürlicherweise wieder eingewandert. Sie alle tragen zum komplexen Gefüge von Arten bei, die auf kleinem Raum miteinander in Beziehung stehen.
Aufgrund seiner Naturschutz-Bestimmungen bildet das Parkgebiet eine wichtige Grundlage für den Vergleich mit gestörten Ökosystemen. Die Frage, wie es um die Biodiversität im Schweizerischen Nationalpark steht, ist insbesondere deshalb interessant, weil hier schon seit über 100 Jahren systematische Untersuchungen zur Pflanzen- und Tierwelt (Flora und Fauna) durchgeführt werden.
Hier finden Sie Erkenntnisse aus verschiedensten Forschungsprojekten zur Biodiversität im Nationalpark.
Einen umfassenden Bericht zum Zustand der Biodiversität im Kanton Graubünden finden Sie → hier.